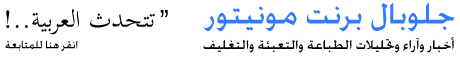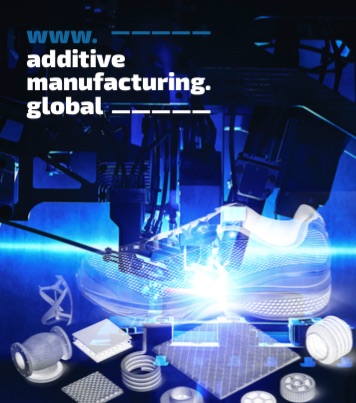Maschinenbauer KBA-Kammann hat in den letzten zehn Jahren eine fundamentale Krise gemeistert. Geschäftsführer Matthias Graf blickt wieder zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen knüpft an Erfolge in seinem traditionellen Kerngeschäft an - und spürt nach der Übernahme durch KBA Rückenwind.
Matthias Graf ist seit 2005 Geschäftsführer der Kammann Maschinenbau GmbH in Bad Oeynhausen. Seit KBA das Unternehmen Mitte 2013 übernahm, firmiert es als KBA-Kammann GmbH. Die Westfalen entwickeln und bauen seit 1955 Maschinen zur Veredelung von Hohlkörpern aus Glas, Kunststoff und Metall.
Herr Graf, der Ursprung von KBA-Kammann liegt mitten im Wirtschaftswunder. Wie kam Gründer Werner Kammann 1955 auf das Bedrucken von Hohlkörpern?
Matthias Graf: Ein lokales Unternehmen brauchte Maschinen, um Messskalen auf Laborglas zu drucken. So hat alles begonnen. Das Unternehmen ist schnell gewachsen, hat dann im Verpackungsbereich Fuß gefasst und Maschinen zum Veredeln von Shampoo-, Spülmittel- oder auch Bohnerwachs-Verpackungen gebaut. Der Konsum nahm zu, die Firma wuchs und wurde internationaler.
Seit der Übernahme führen Sie die Marke KBA im Namen: KBA-Kammann. Welche Erwartungen knüpfen Sie an diese neue Ära ihres Unternehmens?
Graf: Wir fühlen uns in dieser neuen Umgebung sehr wohl. Seit 2005 sind wir durch die Hände zweier Finanzinvestoren gegangen. Nun haben wir einen strategischen Partner, der im Maschinenbau zuhause ist und die Unwägbarkeiten kennt. KBA hat die Kraft, um neben der Restrukturierung ihres Kerngeschäfts neue Märkte anzugehen. Wir profitieren von dem globalen Vertrieb und erhalten Zugang zu Großkunden, die uns vorher nicht wahrgenommen haben. Der Name KBA öffnet Türen.
Wo sehen Sie Ihre Wachstumspotentiale?
Graf: Wir waren schon vor der Übernahme in Nischenmärkten in verschiedenen Regionen tätig. Unsere Märkte sind relativ abgeschottet, haben im Umkehrschluss aber keine überproportionale Wachstumsperspektive. Die sehen wir eher durch den Anschluss an die KBA. Einerseits in Regionen, wo wir bisher noch nicht so stark vertreten waren oder noch keine Nachfrage nach unseren Maschinen bestand – dazu zählt auch China...
...China?
Graf: Ja. Die Automatisierung in Nischenmärkten wie der Hohlkörperveredelung setzt dort gerade erst ein. Hier ergeben sich durch die Vertriebs- und Serviceorganisation und die starke Marke KBA unwahrscheinlich viele Synergien für uns. Solche Strukturen könnten wir als kleineres mittelständisches Unternehmen gar nicht aufbauen.
Und andererseits?
Graf: Können wir nun große Brands im Design und in den Dekorationsverfahren für ihre Produkte unterstützen. Diese Einflussmöglichkeit hatten wir als kleiner Mittelständler nicht.
Wie sieht diese Einflussnahme aus?
Graf: Wir können die gesamte Kette für den exklusiven Markenauftritt anbieten: Von der edlen Faltschachtel aus Radebeul über die Metallverpackung aus Stuttgart bis zum Direktdruck auf Hohlkörpern aus Glas, Kunststoff oder Metall.
Welches Entwicklungspotential steckt noch im Druck auf Hohlkörper?
Graf: Die Relationen zwischen Klebe- bzw. Inmould-Etiketten und dem Direktdruck sind relativ gefestigt. Aber der Konsum nimmt weltweit durch die wachsenden Mittelschichten zu. Wir bewegen uns vor allem in den Bereich Hygieneartikel, Parfüms und Kosmetika oder auch hochwertige Spirituosen. Die Anforderungen sind hoch. Direktdekoration wird von Kunden als hochwertig wahrgenommen und unterstützt das Image der Marke. Wir partizipieren am Trend zu höherwertigen Gütern und haben es mit relativ krisensicheren Märkten zu tun.
Die Workshop-Reihe „Print 2030" des Fachverbands Druck- und Papiertechnik im VDMA hat Produktveredelung und -individualisierung durch Druck als zentralen Trend ausgemacht...
Graf: ...da sind wir mittendrin. Seit einigen Jahren haben wir uns vom reinen Anbieter von Siebdruckmaschinen zum Anbieter von flexiblen Transportsystemen weiterentwickelt, auf denen unterschiedlichste Veredelungsverfahren untergebracht werden können.
Das müssen Sie genauer erklären.
Graf: Die Anforderungen verschieben sich in Richtung Flexibilität. Veredelungsverfahren, die bisher gar nicht kombiniert oder allenfalls parallel in Einzelschritten durchgeführt wurden, gilt es nun inline in ein- und derselben Maschine zu integrieren. Solche Inline-Prozesse sind anspruchsvoll. Siebdruck, Heißprägeverfahren zum Aufbringen von Folien und Metall, Tampondruck oder digitale Inkjet-Verfahren, UV-Härten zur schnellen energiesparenden Trocknung – das sind Felder, die wir nun parallel vorantreiben und je nach Kundenwunsch kombinieren und integrieren.
Das klingt nach hohen Ansprüchen an die Modularität und entsprechend nach jeder Menge Schnittstellenarbeit.
Graf: Unsere Maschinen sind im Baukastensystem aufgebaut. Standardisierte „Bausteine" lassen sich individuell kombinieren. Drei Viertel unserer Kunden sind Lohndrucker, die bei der Anschaffung nicht wissen, welche Anforderungen im Lebenszyklus der Maschine von Kundenseite auf sie zukommen. Sie brauchen flexible, universelle Maschinenkonzepte. Und die setzen voraus, dass wir Kompatibilitätsfragen unterschiedlicher analoger und digitaler Verfahren im Vorfeld sauber lösen.
Bei alledem sagen Sie, KBA-Kammann entwickle sich immer mehr zum Anbieter von flexiblen Transportsystemen. Ist der Transport so kompliziert?
Graf: Der Transport und die präzise Ausrichtung des Artikels unter dem Druckwerk sind in unserem Bereich eine echte Herausforderung. Es geht um edle Anmutung. Da ist Qualität gefragt. Es gilt, unsere Dekorationen mehrfarbig auf hundertstel Millimeter genau auf Glas- oder Kunststoffartikel aufzubringen, die in sich Toleranzen im Millimeterbereich aufweisen.
Wie ist so ein Prozess zu überwachen und steuern?
Graf: Optische Kontrolle ist zentral. Ohnehin bleibt der Artikel während des gesamten Prozesses im Werkzeug. Dabei gilt es, ihn exakt für jeden Dekorationsschritt auszurichten. Das ist nur mit Servotechnik und Kamerasystemen umsetzbar, die mechanische Passernasen komplett verdrängt haben. Wir bieten über ein halbes Dutzend Optionen zur Detektion der Artikel an – und natürlich läuft auch die Qualitätskontrolle mit Bildverarbeitungssystemen.
Ein hoher technologischer Aufwand. Wie groß ist ihre Entwicklungsabteilung?
Graf: Etwa ein Viertel unserer Stammbelegschaft ist in Engineering und IT tätig. Wir kaufen auch Expertise in der Bildverarbeitung zu. Doch wir legen Wert auf Inhouse-Kompetenz. Unsere Entwicklungstiefe - gerade auch in der Softwareentwicklung – ist in unserem Markt unüblich. Doch sie hat für uns höchste Bedeutung, hier wollen wir uns keiner Limitierung unterwerfen, die
mit Auslagerung einhergeht. Weitere Kernkompetenzen sind der globale Vertrieb und die Montage. Wir sind nicht mehr der klassische Maschinenbauer mit Fräsen und Umformtechnik. Dafür gibt es genügend Anbieter in unserer Region und auch in der KBA-Familie. Wir fokussieren uns auf die Eigenentwicklung, Steuerungssoftware, Elektronik und Elektrik der Maschinen sowie auf die eigene Montage samt Qualitätssicherung.
Damit hat sich KBA-Kammann zum Technologie-Unternehmen entwickelt...
Graf: Das war nötig. Wir agieren in Nischen. Wir bauen 40 bis 50 Maschinen im Jahr, in die immer mehr Knowhow fließt. Alle sind unterschiedlich konfiguriert. Hohe Fertigungstiefe lohnt sich bei dieser Stückzahl nicht. Vielmehr zählen die Entwicklung frei kombinierbarer Module und möglichst vieler Gleichteile, um nicht bei jeder Maschine neu anzufangen. Das ist eine Strategie für den deutschen Maschinenbau. Unsere Stärke liegt in kundenspezifischen Lösungen. Baukästen sind der Weg zu marktfähigen Preisen und sie lassen zugleich Raum, dem individuellen Kunden Sonderwünsche zu erfüllen und seine ganz spezifischen Probleme zu lösen.